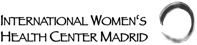10 April, 2025
10 April, 2025
Was ist post-zytäre Narbenfibrose?
Postoperative Fibrose ist eine natürliche Reaktion des Körpers nach einer Operation, wie einem Kaiserschnitt. Dabei bildet sich überschüssiges Narbengewebe, das Verwachsungen zwischen verschiedenen Gewebeschichten verursachen kann, die normalerweise reibungslos übereinander gleiten sollten: Haut, Muskeln, Faszie, Peritoneum oder innere Organe. Obwohl dieser Prozess Teil der Heilung ist, kann er funktionelle Probleme, Schmerzen und Einschränkungen verursachen, wenn er nicht richtig behandelt wird.
Warum entsteht Fibrose nach einem Kaiserschnitt?
Nach einem Kaiserschnitt beginnt der Körper einen Entzündungsprozess, um das beschädigte Gewebe zu reparieren. Fibroblasten produzieren Kollagen, um die Wunde zu schließen. Wenn die Kollagenproduktion übermäßig oder unorganisiert erfolgt, entsteht dichtes Narbengewebe, das an Elastizität verliert und die Beweglichkeit einschränkt. Diese Verwachsungen können sich zwischen der Hautnarbe und tieferen Schichten des Bauches bilden und sogar innere Organe wie Blase oder Darm beeinträchtigen.
Häufige Symptome der post-zytären Fibrose
Verwachsungen nach einem Kaiserschnitt verursachen nicht immer sofort Symptome, können aber im Laufe der Zeit zu folgenden Problemen führen:
- Anhaltende Bauch- oder Beckenschmerzen
- Spannungsgefühl an der Narbe beim Husten oder Bewegen
- Rückenschmerzen oder Schmerzen, die in die Hüfte ausstrahlen
- Verdauungsprobleme (Blähungen, Gas, Verstopfung)
- Schmerzen beim Geschlechtsverkehr (Dyspareunie)
- Gefühl von „Blockade“ oder Steifheit beim Bewegen oder Dehnen des Bauches
- Funktionsstörungen des Beckenbodens
Folgen, wenn Verwachsungen nicht behandelt werden
Unbehandelte Verwachsungen können mit der Zeit verhärten und die Lebensqualität beeinträchtigen. Langfristige Folgen können sein:
- Chronische Schmerzen oder anhaltende Entzündungen
- Veränderungen der Körperhaltung und Einschränkungen im Alltag
- Schwierigkeiten bei zukünftigen Schwangerschaften oder Geburten
- Erhöhtes Risiko für Komplikationen bei weiteren Operationen
- Funktionelle urogynäkologische oder Verdauungsprobleme
Wie Physiotherapie bei post-zytärer Fibrose helfen kann
Spezialisierte post-zytäre Physiotherapie ist entscheidend, um Fibrose zu behandeln und Komplikationen vorzubeugen. Effektive Techniken umfassen:
- Perkutane Elektrolyse (EPI): zur Entfernung von fibrösem Gewebe und Wiederherstellung der Gewebefunktion
- Perkutane Neuromodulation: zur Schmerzlinderung, Verbesserung der neuromuskulären Funktion und Beschleunigung der Geweberegeneration, besonders in frühen Stadien
- Radiofrequenz und Schröpfen: zur Verbesserung der Gewebequalität
- Manuelle Therapie und myofasziale Mobilisation: zur Steigerung der Gewebeflexibilität
- Therapeutische Bauch- und Beckenbodenübungen: individuell angepasst
Zusätzlich vermittelt die Physiotherapie Wissen über Narbenpflege, Atmung und Aktivierung der Tiefenmuskulatur, um die Funktion von Bauch und Beckenboden sicher wiederherzustellen.
Wann sollte man nach einem Kaiserschnitt Physiotherapie in Anspruch nehmen?
Idealerweise sollte man einen auf Frauengesundheit spezialisierten Physiotherapeuten innerhalb von 6 bis 8 Wochen nach dem Kaiserschnitt aufsuchen. Perkutane Neuromodulation kann helfen, die Bildung von fibrösem Gewebe bereits in der ersten Woche nach der Operation zu reduzieren. Es ist jedoch nie zu spät, auch Monate oder Jahre später mit der Therapie zu beginnen.
Fazit
Post-zytäre Fibrose ist häufig, aber behandelbar. Das Erkennen der Symptome und eine gezielte physiotherapeutische Behandlung können den Unterschied zwischen Schmerz und wiederhergestellter Funktion und Wohlbefinden ausmachen. Wer nach einem Kaiserschnitt Beschwerden, Veränderungen am Bauch oder Schmerzen bemerkt, sollte dies nicht ignorieren, sondern sich an einen spezialisierten Physiotherapeuten wenden und die Ursache gezielt behandeln.
Literatur und wissenschaftliche Evidenz
- Järvinen TA et al. “Muscle injuries: biology and treatment.” Am J Sports Med. 2. 3. 4. 5. 6. 2005.
- Diamond MP, Freeman ML. “Clinical implications of postsurgical adhesions.” Hum Reprod Update. 2001.
- Tabibian N et al. “Abdominal adhesions: a practical review of an often overlooked diagnosis.” World J Gastroenterol. 2019.
- López-de-Celis C et al. “Effectiveness of physiotherapy interventions for abdominal scars: a systematic review.” Physiotherapy Theory and Practice 2022.
- Vercellini P et al. “Adhesions and pain in gynecology.” Curr Opin Obstet Gynecol. 2009.
- Hidalgo-Tallón J et al. “Tratamiento de las adherencias mediante electrólisis percutánea intratisular (EPI®): una propuesta clínica.” Rev Int de Ciencias del Deporte. 2018.